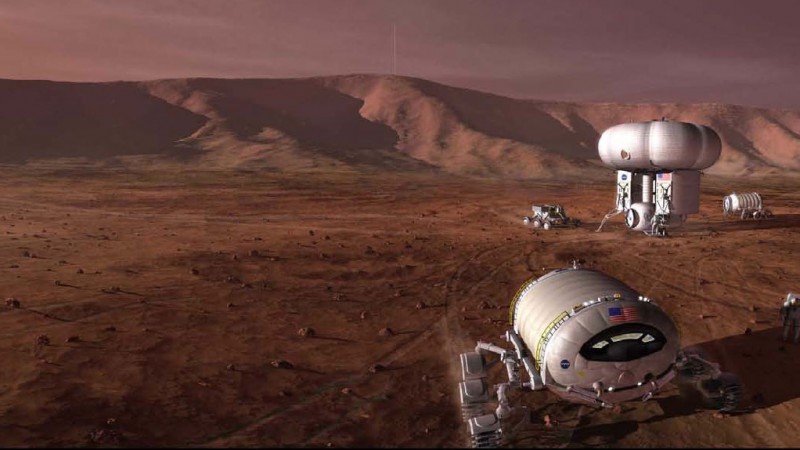Serie „Unsichtbare Logistik“, Teil 3: Wie entsorgt man ein Atomkraftwerk?

Ein Arbeiter passiert eine Schleuse zum Reaktorgebäude des Kernkraftwerks Mühlheim-Kärlich. (Foto: picture alliance/Thomas Frey/dpa)
Mit der Zustellung oder dem Versand von Paketen kommen viele Menschen im Alltag in Berührung. Doch es gibt viele Logistikbereiche, die für die meisten Menschen „unsichtbar“ bleiben. In einer kleinen Beitragsserie beleuchten wir drei besonders ungewöhnliche Bereiche: Medizintransporte, Raumfahrt- sowie Entsorgungslogistik.
Herausforderung AKW-Rückbau: Daran dachte vor 50 Jahren niemand
Als Henry Ford Anfang des 20. Jahrhunderts seine Autos baute, machte er sich auch Gedanken über die Entsorgung der Verpackungen, in denen ihm seine Bauteile geliefert wurden. Er zerlegte die Holzboxen und verwendete sie als Boden einiger früher Modelle. Ford arbeitete damit nach einem Prinzip, das die Entsorgungslogistik noch heute bestimmt: Abfall soll möglichst vermieden werden.
Jeder Haushalt und jedes Unternehmen produzieren Tag für Tag tonnenweise Müll, der recycelt, verbrannt oder deponiert werden muss. Knapp 10 Prozent der beförderten Güter in Deutschland sind laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes auf dem Weg zu ihrer Entsorgung. Und dabei bilden nicht der Haus-, Fahrzeug-, Elektronik- oder Industriemüll den größten Berg: Von gut 400 Millionen Tonnen Müll pro Jahr machen Bau- und Abbruchabfälle mit 209,5 Millionen Tonnen den größten Teil aus.
Anlagen wurden nicht für einen Rückbau konstruiert
Zur besonderen logistischen Herausforderung wird ein Bauabbruch, wenn dabei noch gefährliche Stoffe entsorgt werden, wie beispielsweise beim Rückbau eines Atomkraftwerks. Acht Atomkraftwerke sind in Deutschland aktuell noch am Netz, die nun nach und nach abgeschaltet werden – die letzten drei spätestens 2022. Anders als bei Hausmüll, der verbrannt, oder Straßenschutt, der aufbereitet wird, steht man hier vor einem Problem: „Rund zwei Prozent eines AKW muss als hochradioaktives Material ins Endlager. Und die Zwischenlagerung ist aufwendig und teuer“, sagt Sascha Gentes. Der Bauingenieur ist Professor für den Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Als man die Anlagen vor 50 Jahren konstruierte und baute, dachte man daran, dass sie sicher, robust und störanfallresistent sein sollten – nicht an den Rückbau. Entsprechend gibt es meterdicke Wände ohne Fugen und Durchlässe, um größere Geräte hineinzubringen. „Man beginnt erst einmal mit dem Aufbau einer Infrastruktur und Logistik, um alles Nötige in das Kraftwerk zu bringen“, sagt Gentes. Denn der Abbau muss von innen nach außen erfolgen. „Als erster Schritt müssen die Brennelemente raus und in Lagerbecken gelagert werden, Flüssigkeiten müssen raus, die Turbinen und das Reaktordruckgefäß“, sagt Gentes.
Roboter sollen Probleme langfristig lösen
Doch dazu müssen sie zerkleinert werden. Zerlegt wird per Fernsteuerung, rund zehn Meter unter Wasser als Schutz vor der Strahlung. Eine schwierige Arbeit: „Man kennt das ja, wenn man vom 5-Meter-Brett ins Wasser auf den Boden des Beckens schaut, wie viel man da ein paar Meter unter der Wasseroberfläche noch erkennen kann – und dort müssen wir zentimetergenau arbeiten“, sagt Thomas Eichhorn, der beim französischen Industriekonzern Areva die Abteilung Rückbau leitet.
Aus diesem Grund arbeiten die Firmen fieberhaft an Robotertechnik. Ab 2018 wird im ersten deutschen AKW „Azuro“ eingesetzt. Der Vorteil: Eine sehr kleine Fehlertoleranz und hohe Präzision. Zudem ermüdet er nicht. „Der Roboter sägt, behält das Teil am Greifer, fährt einfach den Arm aus, legt das Teil in den Behälter und schneidet weiter“, sagt Eichhorn.
Möglichst viel des Mülls soll wiederverwertet werden
Neben den radioaktiven Abfällen bleiben immer noch 98 Prozent der Anlage, die auch entsorgt werden müssen: „Was dekontaminiert und freigemessen ist, darf zum Teil weiterverwertet werden: Da kann man zum Beispiel den Stahl einschmelzen und einen Zaun daraus herstellen“, sagt Gudrun Oldenburg vom Entsorgungswerk für Nuklearanlagen.
Der Rest darf nur mit anderen Metallen eingeschmolzen werden oder darf gar nicht wieder in den Kreislauf und wird auf Deponien transportiert. „Man geht ja immer davon aus, dass das ganze Kraftwerk verstrahlt ist, aber das ist überhaupt nicht so. Die meisten Teile kommen überhaupt nicht mit radioaktiver Strahlung in Berührung. Da kann ich einfach mit der Abrissbirne kommen und den Schutt beispielsweise im Straßenbau verfüllen“, sagt Thomas Eichhorn von Areva.
Lesen Sie auch Teil 1 aus der Beitragsserie „Unsichtbare Logistik“ zum Thema Lebensrettende Medizinlogistik sowie Teil 2 Ready For Liftoff – Transport ins Weltall.